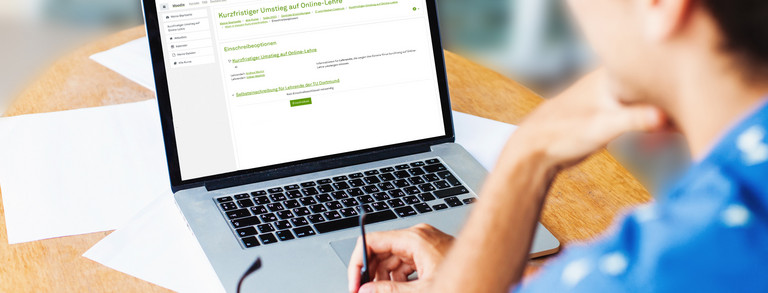Ellen Hilf bei WDR 3 und WDR 5 im Interview

Anlass der Interviews war das in den Medien verbreitet aufgegriffene Ergebnis der Studie: Männer übernehmen in heterosexuellen Partnerschaften weiterhin einen geringeren Anteil der privaten Haus- und Sorgearbeit, schätzen ihn zugleich aber höher ein als ihre Partnerinnen. Wie dies zu erklären wäre, fragte WDR 5-Moderator Robert Meyer im Morgenecho. Im längeren zweiteiligen Interview in den „Resonanzen“ ging WDR 3-Moderatorin Annette Hager zudem stärker auf dem Social-Media-Trend der „Trad Wives“ ein.
Dass Männer ihren Anteil überschätzten, kenne man auch aus früheren Studien, so Ellen Hilf. Das liege auch daran, dass man den Aufwand für Aufgaben, die man nicht selbst erledigt wie auch die, die man selten macht, oft falsch einschätze. Auch würden oft nur die Aufgaben gezählt für den Vergleich, aber nicht der damit verbundene Aufwand angemessen eingeschätzt. Viele Tätigkeiten in Haus- und Betreuungsarbeit seien quasi unsichtbar. Man merke immer erst, wie wichtig diese Arbeit wäre, wenn sie nicht gemacht wird.
Es sei aber doch ganz erstaunlich, wie sich die gesellschaftliche Norm in den letzten 50 Jahren verändert habe. Bis 1977 war es sogar gesetzlich verankert im BGB, dass die Pflicht zur Haus- und Sorgearbeit allein bei den Frauen lag und sie nur erwerbstätig hätten sein dürfen, wenn die Hausarbeit dadurch nicht beeinträchtigt wurde. Heute gelte als Leitbild, dass alle Erwachsenen erwerbstätig seien und die Arbeitsteilung partnerschaftlich sein sollte. Insofern sei es auch ein Ausdruck gesellschaftlichen Wandels, dass Männer Haus- und Sorgearbeit selbstverständlicher übernähmen und dies auch so darstellen wollten. Das spiegele sich beispielsweise auch in der Werbung zu Wasch- und Putzmitteln heute. Da sähe man Männer selbstverständlich bei Hausarbeit. „Früher war der einzige Mann in solcher Werbung Meister Proper.“
Das Grundproblem bestehe darin, wie auch die Studienautorinnen schrieben, dass in der Arbeitswelt immer noch das Leitbild des zeitlich umfassend verfügbaren Erwerbstätigen herrsche, der keine privaten Verpflichtungen hat. Dafür kenne die Forschung auch den Begriff der „Sorgevergessenheit“. Sorgearbeit, so Ellen Hilf, sei gesellschaftlich grundlegend notwendig. Ohne Sorgearbeit könne sich weder der einzelne Mensch erhalten noch die Gesellschaft als Ganzes. Sie werde in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung jedoch nach wie vor nicht angemessen anerkannt.
Auf die Frage, ob es nicht auch an Rollenstereotypen liege? Dazu sagte Ellen Hilf, Rollenstereotype wirkten teilweise weiter: Manche Tätigkeiten würden immer noch als weiblich oder männlich angesehen. Mancher Mann bekäme Angst um seine Männlichkeit, wenn er als weiblich beschriebene Tätigkeiten übernehme. Das sei aber weniger ausgeprägt als in früheren Jahrzehnten.
Ellen Hilf führte aus, dass Paare das Vereinbarkeitsdilemma heute überwiegend über das sogenannte Zuverdienermodell lösten, bei dem in der Regel der Mann Vollzeit erwerbstätig ist und die Frau Teilzeit arbeitet und den Großteil der privaten Sorgearbeit übernimmt.
Angesprochen auf den Social Media Trend „Trad Wives“ erklärte sie, diesen könne man möglicherweise auch verstehen als eine Ablehnung der Mehrfachbelastung. Die Verfechterinnen blendeten dabei allerdings die großen Risiken aus, die damit für sie verbunden sind, wie Verzicht auf eigenständige Existenzsicherung, massive Abhängigkeit vom Partner, sozialen Absturz bei Trennung und geringe Rente im Alter. Man dürfe den Trend aber auch interpretieren als Reaktion darauf, „dass nicht alles vereinbar ist bei dem Leitbild, das wir nach wie vor für Vollzeiterwerbstätigkeit haben.“
Weitere Informationen:
zum Interview im WDR5_Morgenecho
zum Interview bei WDR 3 Resonanzen Teil 1 und Teil 2
zur IAQ-Projektseite